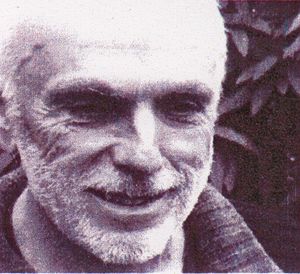Benutzer:Ubeier
Inhaltsverzeichnis
über mich
Jahrgang 1941, in Weißenburg seit 1971; verheiratet, zwei Söhne, vier Enkel
im Ruhestand, vorher Studienrat an der Realschule Weißenburg
bereits bearbeitete Themen
Altmühl, Brombachsee, Igelsbachsee, Hahnenkammsee, Schwäbische Rezat, J.Lidl, Fr. Liebl, Dr. Otto "Leo", Fleppa, E.Model, Ergänzung Dettenheim u. R. Nebel, Friedrich-Ebert-Str., J.Schieder, G.Demel, Anlauter, 5 Artikel v.H. Spitschka, Rennweg, SL WUG, Wohnstättennamen, Wülzbg.-Gedenkst., Heimatbücherverz., Bahnhofstr., Karl IV., Landschaftsbild, 4 Artikel Mundart (Mertens), 3 Artikel über die Schambach, HNavratil, StHedwigMB, Erzgeb.stub. GUN, OBSchwirzer, Hist. Stammtisch (40), Exulantennamen, WUG-SEB, OStiepak, RainMesserer, Bombard. Wßbg., 5 Zeitzeugenberichte (50), Papp.Ehrenbg., Ergänzg. Wßbg.Bgm., AlBinkert, JohMertens, TreuchtlMöhrenb., EBW, StrN m. Bez. zu Vertreibg., Schulzentrum, Stichvillapark, E.-Schulhoff-Str. (60), Einwohnerzahlen aktualisiert ab 1960, Patensch., 2x RSWUG, AHochmuth, MWenz, Wßbg. FlN 1-4 (70), RJoppien, JZörkler, Gesch. Bez. WUG-Sudeten, 3x Europ. Hauptwasserscheide, 3 x Name Wßbg. eur. Vgl., MRaab (80), JMang, FEigler, WBlendinger, Namensvett. Bergen, Ellingen, 2 Nennsl. Kirchen, Treuchtlg.-Mahnm., Wehrkirch., JosReinfuss (90), Stadtmauer 19.Jh.,
Hermann Sturm (* 24. August 1943 in Burk/MFr.) ist Diplom-Ingenieur und Schreiner, außerdem ein vielseitiger Weißenburger Künstler, der sich seit langem in die evang. Kirchengemeinde einbringt.
Leben und Wirken
Hermann Sturm wurde 1943 in Burk bei Dinkelsbühl (heute Landkreis Ansbach) geboren, kurz nachdem sein Vater im 2. Weltkrieg in Russland gefallen war. Nach dem Hermanns Abschluss der Volksschule zog die Mutter in ihre Heimat nach Weißenburg. Hier folgte seine dreijährige Lehrzeit als Schreiner. Nach dem Besuch des Vorkurses für Ingenieurschulen in Nürnberg und verschiedenen Praktika schloss sich ein dreijähriges Studium an der Staatlichen Ingenieurschule für Holztechnik in Rosenheim an, das er als Dipl.-Ing. (FH) abschloss. Es folgten berufliche Tätigkeiten in verschiedenen Industriebetrieben (u. a. Lundia in Weißenburg). 1970 heiratete er Johanna Neumeier, die Tochter des Karl Neumeier, in dessen Schreinereibetrieb er arbeitete. Nach dem Tod des Schwiegervaters bis zum Beginn des Eintritts in die Rente 2006 leitete Sturm den Betrieb. Der Ehe entstammen zwei Kinder (Holger und Katrin).
Hermann Sturm ist künstlerischer Autodidakt als Bildhauer und Maler. Er besuchte Kurse bei Rainer Joppien, nahm am "Schwäbischen Kunstsommer" im ehem. Kloster Irsee und einem Bildhauerkurs der VHS München in Buchenried am Starnberger See teil. Hervorzuheben ist Sturms Vielseitigkeit sowohl in Bezug auf die Themen als auch auf die Techniken und Materialien, mit denen er arbeitet.
Orte mit Einzelausstellungen von Hermann Sturm:
Söller des Gotischen Rathauses in Weißenburg
Ludwigsburg, Karlshöhe
Neues Rathaus Weißenburg (anlässlich dessen Eröffnung)
St.-Andreas-Kirche Weißenburg (dreimal)
Europalast Straßburg
Dauerausstellung:
art villa (ehem. Lungenheilstätte) Am Rohrberg 17, Weißenburg, Besichtigung nach Vereinbarung (Tel./Fax 09141/73803)
Ausstellungsbeteiligungen:
Kulturfabrik Roth
Kunsttage Büchenbach
Ausstellung "Kunst und Klang" im evang. Gemeindehaus Weißenburg
Eröffnung der Kunstschranne Weißenburg
Kunsttage Weißenburg
Ausstellung in Wolframs-Eschenbach
Ausstellung in Hilpoltstein
Öffentliche Arbeiten:
Figurengruppe und Bilder im Neuen Rathaus in Weißenburg
Volksaltar in der St.-Andreas-Kirche in Weißenburg
Altar in der Michaelskapelle, dem Meditationsraum der St.-Andreas-Kirche in Weißenburg
Triptychon im Philipp-Melanchthon-Haus in Weißenburg, Galgenbergsiedlung
großes Reliefbild "Trauer und Hoffnung" in der Aussegnungshalle des Westfriedhofes in Weißenburg
Skulpturensäulen und Reliefbild im Neubau des Sonderpädagogischen Förederzentrums in Weißenburg
Bild im Büroraum der Sparkasse Mittelfranken-Süd, Hauptgeschäftsstelle in der Friedr.-Ebert-Str. in Weißenburg
Außenwandbild "Sportszene" beim Kaufhaus "Intersport Steingass" in Weißenburg
Würdigung
"Der Holzingenieur Hermann Sturm bringt die Liebe zum Werkstoff Holz und sein handwerkliches Können in sein künstlerisches Tun. Mehr aber noch die Lust, entgegengesetzt zum vorgegebenen strengen Maß in der berufliche Arbeit, Empfindungen, Eindrücke und Erfahrungen in freies explosives Gestalten umzusetzen."[1]
"Ich glaube, es ist Hermann Sturm gelungen, etwas von der Schöpfung Gottes einzufangen. ... Das Motto "Kunst und Klang" wurde auch in den plastischen Arbeiten von Hermann Sturm direkt umgesetzt. Dass er als Schreiner in Holz arbeitet, versteht sich dabei von selbst. Das zeigt sich auch in dem formal und farblich gelungenen Gemälde "Quartett", das mich an Amadeo Modgliani oder manche Bilder von Marc Chagall erinnert. Wer die musikalische Begabung Sturms kennt, ist nicht überrascht, dass auch Musisches in seinen Werken mitschwingt." [2]
Darüber hinaus brachte und bringt sich Hermann Sturm als Kirchenvorstand der evang.-luth. Kirchengemeinde St. Andreas Weißenburg sowie in deren Posaunenchor und Kantorei ein.
Fußnoten
Die Sanierung der Stadtmauer in der Zeit von 1950 bis 2014
Von der äußeren, etwa zwei Kilometer langen, Stadtmauer sind das Ellinger Tor und 35 Türme erhalten geblieben. Das Spitaltor gehört zur ersten Umwallung. Ein großer Teil dieser historischen Wehranlage ist heute in städtischem Besitz. Die Stadt Weißenburg hat bei allen großen Zukunftsprojekten, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu bewältigen waren, immer wieder Geld bereitgestellt, um Teile der Stadtbefestigung nach und nach instand zu setzen und so die Erhaltung der mittelalterlichen Bausubstanz zu sichern. Die Fotografin, Text- und Buchautorin Ursula Pfistermeister schreibt über diese Bemühungen Folgendes: „Inzwischen lässt sich die Stadt die sachgemäße Wiederherstellung der Wülzburg ebenso angelegen sein wie den Unterhalt ihrer Stadtmauer, die zu den besterhaltenen Frankens zählt".[1]
Die Stadtverwaltung achtet bei Um- und Einbauten im Bereich der Stadtmauer streng darauf, dass „das Gesicht des Mittelalters gewahrt bleibt.“[2]
Im Jahre 1967 hatte der damalige Stadtrat den Grndsatzbeschluss erlassen, die Wallgräben von jeder Bebauung freizuhalten und diese in Erholungszonen (Grünanlagen, Spielplätze) umzuwandeln. Das Liegenschaftsamt der Stadt versuchte deshalb in den zurückliegenden Jahren immer wieder Grundstücke im Bereich der Stadtgräben zu erwerben und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In der Regierungszeit von Oberbürgermeister Dr. G. Zwanzig zeigten sich bereits erkennbare Ergebnisse, und unter der zielstrebigen und konsequenten Umsetzung dieses Stadtratsbeschlusses unter seinem Nachfolger R. Schwirzer konnten zahlreiche Erfolge verbucht werden.
Sanierungsmaßnahmen an der Weißenburger Stadtmauer von 1950 bis 2014 Datei:Stadtmauer 0001 NEW (500x442).jpg
Von diesen Sanierungsmaßnahmen sollen folgende Beispiele ausführlicher dargestellt werden:
A. Die Seeweihermauer am Knepperlesbuck
Im Jahre 1983 wurden die Stadtmauer und der Wehrgang am Seeweiher zwischen den Türmen Nr. 39, 37 und 35 hervorragend wiederhergestellt. Bei dieser Baumaßnahme erfolgte auch die Beseitigung von angebauten Ställen und Stadeln, sodass der Mauerverlauf jetzt gut erkennbar ist.
B. Der Neubau des Evang. Gemeindehauses St. Andreas in den Jahren 1988 - 1989
1986 plante der Kirchenvorstand unter Dekan H. Issler im Mesnergarten den Bau eines Gemeindehauses mit Gruppenräumen für Jugend- und Altenarbeit, Frauen- und Mütterkreis, Singkreis, Gustav-Adolf-Frauenwerk, Kantorei, Bibelstunde, Posaunenchor, Präparanden- und Konfirmandenunterricht, Konfirmandenelternabende usw. Die Garagen hinter dem Mesnerhaus sollten abgerissen werden. Der Neubau mit rund 21 m Länge und mit Tiefgarage war im Mesnergarten in Ost-West-Richtung vorgesehen.[3] Da es sich hier um eine städtebaulich empfindliche Baugruppe handelte, schaltete sich das Landesamt für Denkmalschutz ein. Durch eine Planänderung des Architekten wurde nun der Neubau in Nord-Süd-Richtung geplant.[4] Die Erdarbeiten begannen im Februar 1988. Dabei wurden die Reste der Stadtmauer im Westen freigelegt. Auf diesen Fundamenten wurde die „neue Stadtmauer“ hochgezogen.
Das Weißenburger Tagblatt schrieb damals: „Erstmals seit dem Mittelalter ist ein Stück der historischen Stadtbefestigung, der Stadtmauer, wieder aufgebaut worden.“[5] In der weiteren Berichterstattung der hiesigen Lokalzeitung wird diese „neue Stadtmauer“' während der gesamten Bauzeit immer wieder positiv beurteilt. Die weiteren Kommentare lauteten: Ein "Wehrgang" für den Glauben[6] – „Wirklich wie ein Stück Stadtmauer“[7] u. ä.
Mit dem Bau des evang. Gemeindehauses wurde der Fußweg auf der Innenseite der Stadtmauer vom Scheibleinsturm her durch einen schmalen Durchlass in der wieder aufgebauten Stadtmauer zum Postamt weitergeführt.
Um 2000 erfolgte eine Neugestaltung der Grünanlage zwischen St.-Andreas-Kirche und Postamt. Dabei wurde der Verlauf der ehemaligen äußeren Stadt- und der Zwingermauer durch Steinpflasterstreifen angedeutet und z. T. bis in Kniehöhe aufgemauert. Am 30. Oktober 2014 wurde die Lutherstatue von der Westseite der Kirche an den ursprünglich vorgesehen Ort am Martin-Luther-Platz umgesetzt.
C: Die Sanierungsmaßnahme im Bereich des Ellinger Tores 1991/92
Nach einer längeren Vorgeschichte (1981 Abbruch des Hauses Stefani, neue Straßeneinmündung, Anlage von Parkplätzen - 1984 Kauf des Anwesens Schwegler, Schulhausstraße - 1988 Kauf des Anwesens der Schreinerei Essig am Ellinger Tor und 1993 Umbau zum Museumsdepot - 1989 Vollendung der Unterführung zwischen Parkhaus und Wallgraben - 1991 neuer Weg im Garten des Anwesens Essig) wurde der Wallgraben östlich des Ellinger Tores ausgebaggert und der Durchgang unter der Brücke geöffnet. Die freigelegte Buckelquaderstadtmauer aus dem 12. Jahrhundert wurde 1992 saniert, ebenso die Wallgrabenmauer am ehemaligen Zollhaus und am Anwesen Schulhausstraße 1. Der Fußgängersteg daneben wurde am 13. November 1992 der Öffentlichkeit übergeben. Die historische Brücke zeigte allerdings massive Schäden, sodass Sanierungsmaßnahmen erforderlich waren.
Am 15. März 2014 begannen die Abbrucharbeiten am Haus Schulhausstraße 5 (früher Elektro Schwegler). Das zuletzt dort untergebrachte Jugendzentrum fand im ehem. Gasthof "Zum Kronprinzen", Eichstätter Str. 1, ein neues Zuhause. Im August desselben Jahren gelang endlich der Abriss der Wellblechgaragen am Wallgraben westlich des Ellinger Tores. An deren Stelle entstand ein 6 x 8 m großer Carport aus Holz, dessenBau nihct unumstritten ist, weil er nicht dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates, den Wallgraben von jeglicher Bebauung freizuhalten.
D.
E. Die Sanierungsarbeiten auf dem Schrecker 1994/94
1995 wurden beim Bau der neuen Straße zwischen den Türmen 15 und 11 die Fundamente der inneren Stadtmauer freigelegt und deren Verlauf im Straßenpflaster sichtbar gemacht. Ebenfalls freigelegt wurden die Fundamente des Schrecker-Rundturmes; dieser war 1823/24 abgebrochen worden. Der Stadtrat entschloss sich zu einer Teilrekonstruktion dieses Turmes (1996). 1997 bezog die Rheumaliga den Stadtmauerturm Auf dem Schrecker Nr. 11, nachdem dieser gründlich renoviert worden war. Das Gebäude im Wallgraben der Nördlichen Ringstraße (ehem. Foto Cernjak) wurde nach Geschäftsaufgabe des Inhabers und des schlechten Bauzustandes des Gebäudes am 18. Mai 2010 abgerissen.
F. Maßnahmen beim ehemaligen Frauentor
Die für 2004/2005 geplante Freilegung der ehemaligen Brücke vor dem Frauentor wurde nicht in Angriff genommen. Etwa zur gleichen Zeit entfernten die Städtischen Werke im südlichen Wallgraben wieder den Anbau eines Transformatorenhäuschens mit Aussichtsplattform an einem Stadtmauerturm.
G. Verbesserungen am nördlichen Ende des Seeweihers
1982 öffnete man hier die Tür in der Stadtmauer für einen Fußgängerweg, wodurch dieAnbindung des Schulviertels an die östliche Altstadt gelang. 1993 erwarb die Stadt drei Grundstücke im Stadtgraben. 1995 wurde dort auch ein Kinderspielplatz angelegt. Mitte Dezember 2000 erfolgte der Abriss des maroden Hauses Seilergässchen 4 (ehem. Anwesen Heil) und der dazugehörige Garten wurde in die öffentliche Grünfläche miteinbezogen.
Quellen:
NEUMANN, Werner: Die Sanierung der Stadtmauer in der Zeit von 1950 bis 2000 in: Weißenburg i. Bay. und Umgebung 1950 - 2000. Erdkundlich-geschichtlich-sozialkundliche Untersuchungen des Nahraumes; Hrsg. Staatliche Realschule Weißenburg unter Leitung von Ulf BEIER 2001, S. 55-57
NEUMANN, Werner: Geschichte des Nahraumes in: Jahresbericht der Staatl. Realschule Weißenburg 2001/2002, S. 79; handschriftliches Manuskript zu Untersuchungen über die Veränderungen an der Weißenburger Stadtmauer in der Zeit von 2001 bis 2014
Bearbeitung der Quellen: BEIER, Ulf, Weißenburg
Fußnoten
- ↑ PFISTERMEISTER, Ursula: Wehrhaftes Franken, Burgen, Kirchenburgen, Stadtmauern, Bd. 1: um Nürnberg, Nürnberg 2000, S. 120
- ↑ 2.SIEGHARDT, August; MALTER, Wilhelm: Eichstätt mit südlicher Fränkischer Alb und Altmühltal, Nürnberg, 1963, S. 86
- ↑ Weißenburger Tagblatt (WT) Nr. 281 v. 6./7.12.1986
- ↑ WT l06 v. 9./10.05.1987
- ↑ WT 275 v. 19.11.1989
- ↑ WT 216 v. 17./18.09.1988 - Ein Stück Stadtmauer entsteht wieder“
- ↑ WT 270 v. 22.11.1988 - s. a. WT 46 v.24.2.89, WT 284 v. 9./10.12.89, WT 84 v. 10.4.1990
Neuer Abschnitt
Der/die Kontrollierende bei Wikipedia geht bei der Bevölkerung des Altvatergebirges von der falschen Voraussetzung aus, es habe dort vor 1945 eine nennenswerte tschechische Bevölkerungsgruppe gegeben, die tschechische Flurnamen und damit Bergnamen hatte. Die Statistiken widerlegen dies. z. B. für die Volkszählung vom 31.12.1910: 1. „Österreichische Statistik“; Hsg. von der K. K. Statistischen Zentralkommission, Wien; 1. Band 2. Heft und 2. Band, 1. Heft; Wien 1913/14 – 2. „Spezialrepertorium von Mähren“, Hsg. von der K. K. Zentralkommission, Wien 1918 – 3. „Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien nach Bevölkerungszahl, …, Umgangssprache,…; Hsg. vom Landesstatistischen Amte; Troppau 1912 (gemeint ist Österreichisch Schlesien), und ebenso die Statistiken der Tschechoslowakischen Republik von 1921 und 1930.
Die zweisprachige Karte von 2006 ist kein Beweis für frühere Zweisprachigkeit. Eine zweisprachige Karte vor 1914 ist mir nicht bekannt.
Nachdem Sie eine Begründung bei der Wortkonkordanz ablehnen, warum es für das Altvatergebirge deutsche Flurnamen gibt, greife ich Ihren Gedanken auf, dies als Untermauerung des ersten Satzes des Stichpunktes „Bevölkerung“ zu tun und als Fußnote zu ergänzen: Laut K. K. österreichischer Volkszählung von 1910 gab es im Altvatergebirge über 99% deutsche Bevölkerung. Der tschechische Bevölkerungsanteil lag in den damaligen Gerichtsbezirken Freiwaldau, Freudenthal, Mähr. Altstadt, Römerstadt und Wiesenberg unter 0,1%.
Und statt des Satzes „Daneben siedelten sich verschiedensprachige …“ empfehle ich treffender, weil die Aussage diese Satzes nicht wirklich greift: „Nach 1919 bildete sich in den Städten eine tschechische Minderheit, die sich vorwiegend aus Staatsbeamten bzw. -bediensteten und deren Familien (Bahn, Post, Polizei, Finanz-, Forstverwaltung, Straßendienste usw.) zusammensetzte. Sie schwankte zwischen 1,7% in Römerstadt (Rýmařov) und 6,2% in Freiwaldau (Jeseník) [1] 1938 nach dem Anschluss dieses Gebietes an das Deutsche Reich wurden diese Bevölkerungsgruppe von der Prager Regierung wieder zurückgerufen und ins Landesinnere versetzt.
1945/46 wurde die deutsche Bevölkerung des Altvatergebirges aufgrund der Beneš-Dekrete enteignet und vertrieben. Sie gelangte vorwiegend in die damalige US-amerikanische oder Sowjetische Besatzungszone, zu einem kleinen Teil auch in andere Teile der späteren Bundesrepublik Deutschland oder Österreichs. Den Bevölkerungsverlust …“
Die Binnenwanderung galt wohl in erster Linie für die Städte, die Dörfer litten eher unter Landflucht.
Zum Hinweis auf den Namen Moskau usw.: Ich kann wohl unterscheiden, was ein Exonym für eine weit bekannte Stadt ist und ein Name für einen bewaldeten Berg im Altvatergebirge. Und ein Gelehrtennamen für ein ganzes Gebirgsmassiv ist eben noch kein Name für die vielen großen und kleinen Berge und Hügel. Schriftliche Belege für originäre tschechische Bergnamen im Altvatergebirge (gemäß alter Urbare oder Giltbücher, mindestens aber vor dem Theresianischen Kataster ab 1750 ff bzw. Landkarten vor 1900, Maßstab 1:200.000 oder größer) wurden von Ihnen noch nicht genannt. Der Name des Kerpernik (Betonung auf der 2. Silbe) ist umstritten, ob urspr. slawisch oder eine Verballhornung aus der gebirgsschlesischen Mundart von Ge-BÄREN-ich (mit Pluralprä- und Pluralsuffix sowie Anlaut- und Auslautverhärtung). Ich halte das für eine pseudowissenschaftliche Erklärung, habe aber nicht die Zeit zur Überprüfung.
Mir ist nicht klar, welche höhere demokratisch legitimierte Autorität Sie zur Missachtung des KMK-Beschlusses von 1991 über den Gebrauch der geografischen Namen außerhalb Deutschlands berechtigt – ein einstimmig gefasster Beschluss der Kultusminister, die 16 demokratisch gewählte Landesregierungen vertreten. Diese von Ihnen geübte Praxis steht im Widerspruch zu „den internationalen Gepflogenheiten“, wie es in diesem Beschluss heißt (vgl. Handhabung in Italien, Spanien, Frankreich …).
Damit beende ich die für beide Seiten zeitraubende Diskussion und konzentriere mich wieder auf den Kontakt zu den tschechischen Wissenschaftlern in Prag, Budweis, Eger und Karlsbad, bei denen Tatsachen nicht mehr gerechtfertigt werden müssen und die KMK-Richtlinien längst geübte Praxis sind.
Fußnoten
- ↑ Volkszählung vom 01.12.1930
Die Formulierung bei der tschechisch-deutschen Wortkonkordanz „Da das Altvatergebirge seit seiner Erschließung auch deutschsprachiges Siedlungsgebiet war, existieren für die geographische_ Angaben deutsche Entsprechungen.“ ist irreführend. Laut k.u.k. österreichischer Volkszählung von 1910 gab es im Altvatergebirge außer der deutschen Bevölkerung keine nennenswerten nationalen Minderheiten und damit keinen Grund für tschechische Bergnamen, so wenig wie für deutsche Flurnamen im tschechischen Sprachgebiet. Man denke an die Immobilität und den niedrigen Bildungsgrad der vorindustriellen Bevölkerung. Warum sollte man da für Berge in Gegenden, in die man gar nicht gekommen ist, anderssprachige Bezeichnungen erfinden? Erst im Zuge des aufkommenden Nationalismus (2. Hälfte 19. Jh. /1. Hälfte 20. Jh.) sind Exonyme entstanden. Lediglich für das ganze Bergmassiv gibt es seit dem Altertum Gelehrtennamen in Griechisch und Latein, später auch in Deutsch, Tschechisch und anderen Sprachen.
„Dabei sind deutsche und tschechische Namen oftmals Übersetzungen.“ ist wissenschaftlich nicht haltbar. Da originäre tschechische Bergnamen für das Altvatergebirge fehlen, gab es auch keine deutschen Übersetzungen. Wer originäre tschechische Bergnamen angibt, sollte die schriftlichen Belege nennen können.
Die korrekte Formulierung für die Begründung der deutschen Bergnamen sollte daher lauten:
Da das Altvatergebirge seit seiner Erschließung bis 1945/46 deutsches Siedlungsgebiet war[1], gibt es für alle Berge auch deutsche Namen. Folgende Aufstellung soll das Zuordnen der Namen für die Hauptgipfel und Pässe erleichtern.
Ein Verzeichnis der deutschen Bergnamen steht am Ende dieses Artikels in der tschechisch-deutschen Wortkonkordanz.
Fußnoten
- ↑ Laut k.u.k. österreichischer Volkszählung von 1910 gab es im Altvatergebirge über 99% deutsche Bevölkerung. Der tschechische Bevölkerungsanteil lag in den Bezirken Freiwaldau, Freudenthal und Mähr. Altstadt unter 0,1%.